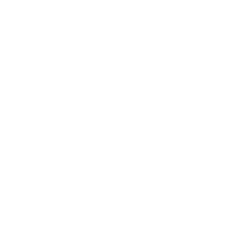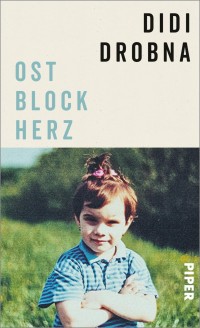Im Damals erzählt Didi von ihrem Aufwachsen zwischen der Slowakei und Österreich, im Heute ringt sie nicht weniger mit der Sprache: »Was würde ich zuerst verlieren – endgültig verlieren – meine Eltern oder meine Muttersprache?«, schreibt sie zu Beginn. Eine Szene, in der Didi auf dem Weg in die Arbeit 20 Minuten im Hauseingang steht, um dem Vater live die Risiken seiner anstehenden Operation zu übersetzen, ist tragisch und komisch, man brüllt jedenfalls vor beiden Emotionen.
Ich würde raten, keinen einzigen Satz zu überspringen, überall lauern die Pointen. Wer sich denkt: Ach, schon wieder ein Migrationsroman, dem sollten schon die ersten Seiten reichen, um seine Vorurteile abzustreifen. Ich könnte ewig weiterschwärmen, aber am besten, man liest es selbst:
Didi Drobna
Ostblockherz
Piper, 176 S.